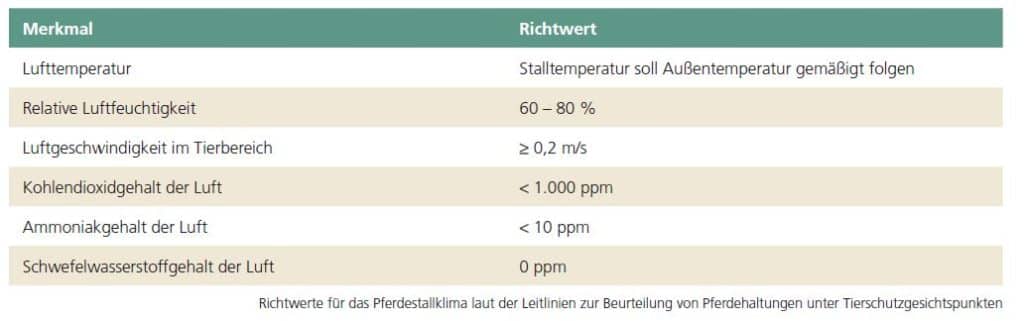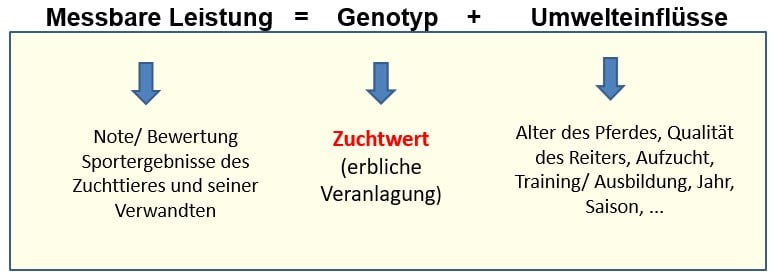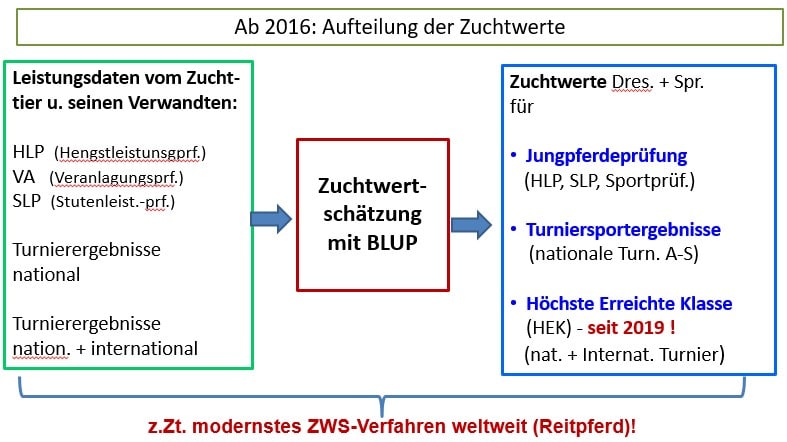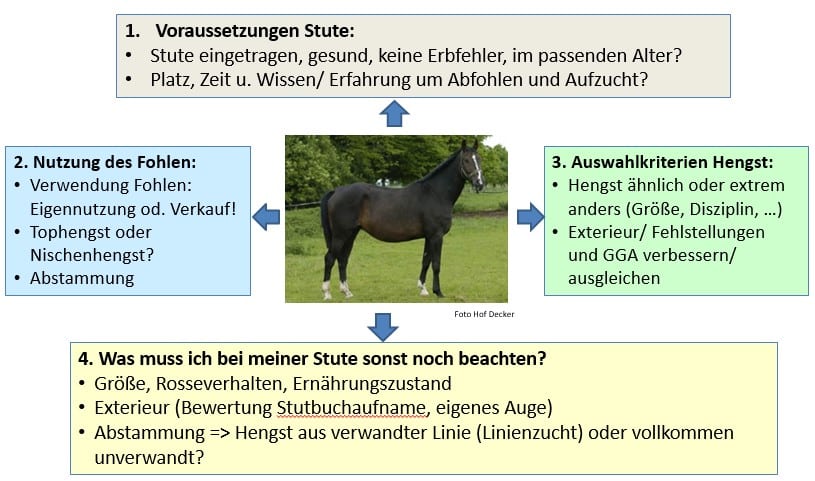[vc_row][vc_column][vc_column_text]Parasiten, ansteckende Krankheiten, Epidemie! Ein Alptraum für Gestüt und Pferdebesitzer. Um Dramen vorzubeugen, ist ein vorausschauendes Hygienemanagement im Stall das beste Mittel. Worauf Sie bei Entwurmung, Impfungen und Desinfektion achten sollten, weiß Dr. Anja Kasparek, die Klinikleiterin der Pferdeklinik Aschheim. Zudem lesen Sie, welche baulichen Maßnahmen und technischen Hilfsmittel verhindern, dass sich Krankheitserreger ausbreiten.
Ansteckende Krankheiten, wie Druse und Herpes sowie unangenehme Parasiten können den gesamten Bestand gefährden. Ein geeignetes Hygienemanagement kommt allen zu Gute, muss aber eben auch von allen eingehalten werden: Dazu gehören ein einheitliches Impf- und Wurmmanagement, ein konsequenter Ablauf, wenn Pferde erkranken und wirksame Desinfektions- und Reinigungsmaßnahmen.
[ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,3″ ihc_mb_template=“3″ ]
Entwurmung
Die Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten schreiben vor, dass der Pferdehalter durch artgemäße Pflege, Ernährung und Haltung für die Pferde-Gesundheit sorgen muss. Dazu gehört auch die regelmäßige und fachgerechte Entwurmung in Absprache mit einem Tierarzt. Bei der Entwurmung gibt es zwei Herangehensweisen: selektiv oder strategisch. Dr. Kasparek erklärt: „Bei der strategischen Entwurmung werden alle Pferde alle drei Monate gleichzeitig entwurmt und anschließend wird desinfiziert. Der Vorteil: Die Wurmlast lässt sich so deutlich senken und die Einsteller besser koordinieren. Der Nachteil: Es bilden sich mehr Resistenzen gegen Wurmmittel und die Auswahl wird geringer.“ Wird selektiv entwurmt, spielen Kotuntersuchungen eine wichtige Rolle im Betrieb: Alle sechs bis acht Wochen müssen dann über jeweils drei Tage Kotproben von jedem Pferd genommen und eingeschickt werden, betont die Tierärztin. Mindestens eine Wurmkur pro Jahr ist auch bei der selektiven Entwurmung notwendig. Das entspricht nur einem Viertel der Dosis bei strategischer Entwurmung aber Dr. Kasparek warnt: „Selektiv zu entwurmen ist sehr beliebt, aber erfahrungsgemäß wird selektiv leider zu lasch umgesetzt“. Nachlässige Entwurmung lässt einige Wurmpopulationen dann regelrecht explodieren: Ein Beispiel dafür ist der Pfriemenschwanz. Dr. Kasparek empfiehlt, sich in jedem Fall betriebsabhängig immer mit dem betreuenden Tierarzt kurz zu schließen – in vielen Ställen ist beispielsweise trotz regelmäßiger Kotprobenuntersuchung mindestens eine „kleine“ und eine „große“ Wurmkur pro Jahr zu verabreichen bzw. Haupausscheider konsequent zu isolieren. Die höchste Wurmlast ist immer im Herbst – am Ende der Weidesaison, daher sollte hier eine gewissenhafte Entwurmung und Weidehygiene erfolgen. Auch bei strategischer Entwurmung sollte man mindestens einmal jährlich eine Kotprobe aller Pferde zu entnehmen. Außerdem verrät sie: „Die „große“ Wurmkur wirkt auch gegen die sogenannten Magendasseln, die Larven der Dasselfliegen.“ Diese werden über an den Pferdebeinen abgelegte Eier aufgenommen und entwickeln sich zu großen Dassellarven weiter die sich beispielsweise an der Magenschleimhaut anheften und dort für Entzündungen sorgen. So können sie auch Koliken auslösen.
Neben Medikamenten helfen auch Routinen im Arbeitsalltag, die Wurmbelastung einzudämmen: „Ganz wichtig ist tägliches Abmisten! Außerdem sollte man Geilstellen ausmähen und neue Pferde zunächst immer separat aufstallen“, rät Dr. Kasparek. Ein regelmäßiges Wechseln der Koppeln trägt ebenfalls dazu bei, dass der Parasitenbefall etwas zurückgeht. Zum Dung der Wiesen besser kommerzielle Dünger oder Rindermist verwenden – Pferdemist sollte nicht erneut auf die Koppeln ausgebracht oder durch Mulchen verteilt sondern entsorgt werden.
Impfungen
Neben ausreichender Bestands- und Haltehygiene schreiben die Leitlinien auch die aktive Immunisierung gegen häufig auftretende Krankheitserreger vor. Direkt angesprochen wird dabei die Impfung gegen Tetanus. Diese sieht Dr. Kasparek ebenso zwingend erforderlich wie die Impfungen gegen Herpes und Influenza. Sie betont: „Alle Pferde müssen uniform geimpft sein – vor allem bei Herpes ist das sehr wichtig. Außerdem würde ich in jedem Fall den FN-Turnierangaben folgen und alle sechs Monate impfen.“ Den kompletten Bestand gleichzeitig zu impfen bedeutet auch, alle Einsteller entsprechend zu koordinieren, was aber im Zweifelsfall für weniger Arbeit übers Jahr gesehen und für mehr Sicherheit seitens des Betriebsleiters sorgt.
Absolut notwenige Impfungen sind laut Dr. Kasparek die Immunisierung gegen Tetanus, Herpes und Influenza: Bei Tetanus führt ein Toxin im Nervensystem zu Wundstarrkrampf, die Symptome werden meist zu spät erkannt, die Pferde sterben. Herpes ist ein Lentivirus, eine sogenannte verborgene Infektion. Betriebsleitern empfiehlt die Tierärztin, ihre Einsteller auch über neuere Erkrankungen und mögliche Gegenmittel zu informieren, das West-Nil-Virus (WNV) beispielsweise: „Eine Impfung halte ich bei WNV langfristig auf jeden Fall für sinnvoll, im Moment würde ich es aber nur als Option aufzeigen und den Einstellern selbst überlassen.“
Untersuchen vor Ort
Kommen neue Tiere auf die Anlage ist eine Untersuchung vorab ratsam. Dr. Kasparek empfiehlt zunächst, die Lymphknoten zu überprüfen und die Temperatur zu kontrollieren: „Anschließend sollte der Neuankömmling noch ein bis zwei Wochen vom Rest der Gruppe getrennt bleiben. Hustet das Pferd während dieses Zeitraums häufiger und kommt der Verdacht auf, es könnte Druse haben, sorgen Spülproben für Klarheit.“
Tipp: Treten dennoch Krankheiten auf, wenn das neue Tiere mit dem Rest der Gruppe zusammentrifft, gilt es zu bedenken, dass es auch latente Träger im Bestand geben kann. Häufig sind das ältere Pferde. Das neue Pferd, das durch die Umgewöhnung gestresst ist, infiziert sich zuerst und scheint der Schuldige zu sein, tatsächlich aber versteckt dieser sich in der Herde. Wichtig ist also in jedem Fall immer den gesamten Bestand zu prüfen.
Um Neuzugänge zu untersuchen oder die in den Leitlinien empfohlene jährliche Zahnkontrolle durchzuführen, eignet sich ein Untersuchungsbereich auf dem Betrieb am besten. Nach Erfahrung der Offenstallplaner von HIT Aktivstall und Schauer sowie Viebrockreithallen plant man diesen Bereich am besten nahe der Wasch- bzw. Putzplätze und des Servicebereichs ein. Auch ein mobiler Untersuchungsstand kann laut André Richter von Viebrockreithallen sinnvoll sein: „Wichtig ist, die Pferde auch während einer Untersuchung möglichst in ihrem gewohnten Umfeld zu belassen. Besonders auf nervöse und junge Pferde wirkt es oftmals beruhigend, wenn sich Artgenossen in ihrer unmittelbaren Umgebung befinden.“ Carola Brandt von Schauer Agrotronic betont, wie wichtig Raum rund um den Untersuchungsstand ist. Sie hält fest: „Man sollte nicht einfach eine Box in einen Untersuchungsstand umfunktionieren, sonst hat man zu wenig Platz. Wenn es mal hektisch wird, soll niemand an die Wand gedrückt werden.“ Der im Regelfall 2 m² große Stand kann an einer Wand eingerichtet werden aber zu den anderen drei Seiten sollte jeweils 4 bis 5 m Platz sein. Bei Gastpferden empfiehlt Brandt noch Platz für ein zweites Pferd einzuplanen. Vivian Westermann von HIT-Aktivstall stimmt zu. Neben Platz für ein zweites Pferd sind ein Strom- und Wasseranschluss, gute Lichtverhältnisse, aber auch die Möglichkeit zur Abdunkelung im Untersuchungsbereich wichtig, hält Westermann fest und führt weiter aus: „Einige Methoden der Zahnbehandlungen bedürfen einer stabilen Aufhängung unter der Decke. Der Untersuchungsraum sollte gut zu reinigen und groß genug sein, um Verletzungen in Unruhezuständen vorzubeugen – auch in der Höhe.“ Für den Bodenbelag im Untersuchungsstand rät Brandt zu festem Betonboden für den Untersuchungsbereich und Gummimatten rund um den Bereich
In Quarantäne
Erkrankte Tiere oder neue Pferde sollten prinzipiell vom Rest der Herde getrennt bleiben. Erkrankt ein Pferd auf dem Betrieb, ist Zeit der wesentliche Faktor: Frühzeitig erkannt, wandert das Pferd direkt in die Quarantänebox. Die Offenstallplaner von HIT und Schauer empfehlen, im Idealfall eine solche Box je zehn Pferde zu haben. Richter gibt zu bedenken: „Die Anzahl der benötigten Quarantäneboxen ist abhängig von der Ausrichtung des Betriebes. Ein Sport- und Turnierstall, in welchem ein hoher Wechsel im Pferdebestand herrscht, braucht eine höhere Anzahl an Quarantäneboxen, als ein Freizeitstall.“
Brandt hat vor kurzem auf ihrem eigenen Betrieb eine Quarantänebox gebaut. Sie berichtet: „In meinem Fall schließt die Isolierbox direkt an den Servicebereich an, ist gemauert und verfügt über ein Paddock. Der Boden ist rutschfest, gut zu reinigen und zu desinfizieren. Dafür ist auch ein direkter Wasseranschluss wichtig.“ Lisa Monßen von HIT-Aktivstall ergänzt: „Idealerweise platziert man Quarantäneboxen in einem ruhigen und nicht für jedermann zugänglichen Bereich des Betriebes.“ Richter rät zudem, die Wände der Quarantäneboxen mit einem Schlagschutz zu versehen, um die Verletzungsgefahr zu verringern. Außerdem warnt er: „Kranke Pferde hören oft auf zu trinken und zu fressen, weswegen wir empfehlen, in den Quarantäneboxen Tränken mit Verbrauchszähler zu installieren, um die Flüssigkeitsaufnahme des Pferdes kontrollieren zu können.“
Oberste Priorität hat es, keinen Kontakt zu den anderen Pferden zu ermöglichen. Dr. Kasparek rät, neue Pferde zunächst ein bis zwei Wochen getrennt zu halten: „Das kann auch in einem Zelt oder mobilem Unterstand sein. Wichtig ist, dass die Gebäude getrennt sind und die Quarantänebox geschlossen ist – vor allem bei erkrankten Tieren. Innerhalb eines Stalles kann eine Tröpfcheninfektion trotz Abstand sonst nicht gebremst werden. Das geht sehr schnell.“ Ebenfalls strikt getrennt müssen die zuständigen Mitarbeiter, das Equipment und möglichst auch die Arbeitswege werden. Kasparek hält fest: „Konsequentes Management der Abläufe ist hierbei enorm wichtig, da sich Erreger auch an den Schuhen oder der Schubkarre festsetzen und verbreiten.“ Richter ergänzt, dass bei Viebrockreithallen zu diesem Zweck ein Schleusenraum eingeplant wird. Er erklärt: „In diesem Raum können sich Personen umziehen und desinfizieren, um keine Erreger und Keime aus dem Stall in andere Bereiche des Betriebes zu tragen. Des Weiteren können dort Dinge wie Decken gelagert werden, welche nicht mit anderen Pferden in Kontakt kommen dürfen.“ Der mit Abstand wichtigste Leitsatz lautet: Eingewöhnungsboxen eignen sich nicht als Quarantäneboxen!
Desinfektion & Sauberkeit
Wenn Boxen ihre Besitzer wechseln und speziell, wenn die Quarantänebox belegt war, ist eine gründliche Desinfektion nötig. Tierärztin Dr. Kasparek erläutert: „Während ein krankes Pferd in der Quarantänebox steht, muss die Box selbst nicht desinfiziert werden, danach aber umso gründlicher. Erst mechanisch und dann mit frei verkäuflichen Desinfektionsmitteln, die auf die Keime abgestimmt sind.“ Speziell die erste Stufe der rein mechanischen Reinigung darf dabei nicht zu kurz kommen und muss an Stellen wie Fugen und Verschraubungen besonders gründlich sein. Sind sichtbare Verschmutzungen entfernt und alles abgetrocknet, werden die Desinfektionsmittel aufgetragen, die durchschnittlich 10 Minuten einwirken müssen. Die genaue Dauer ist produktabhängig und auf dem jeweiligen Mittel vermerkt. Auf dem Weg zur Quarantänebox rät die Tierärztin zusätzlich dazu, Desinfektionswannen aufzustellen oder auch Einmalschuhe zu verwenden. Zudem ist es wichtig, genau zu kontrollieren, wer den Bereich betreten darf und dass die entsprechenden Personen genau wissen, wie sie Hände, Schuhe etc. zu desinfizieren haben und dass sie das Equipment aus der Quarantänebox nicht im Rest der Anlage verwenden dürfen. Monßen betont: „Eine Entfernung jeglicher Einstreu und möglicher Futterreste und eine Reinigung mit dem Hochdruckreiniger ist vorteilhaft. Auch die Tränke sollte gründlich gereinigt werden.“ Richter mahnt auch im Vorfeld zu Routinen wie dem täglichen Abmisten der Quarantäneboxen: „So wird die Anzahl der Erreger in der Pferdebox möglichst gering gehalten. Der Mist sollte generell unzugänglich und in Entfernung zum Stallbereich sowie Futter gelagert werden.“
Zusätzliche Investitionen, die der Sauberkeit dienen können sind das VR Fresh-Air-System von Viebrockreithallen, welches den Quarantänestall bei Leerstand automatisch reinigen soll, oder auch das Produkt Cleanlight. Diese Waschplatzleuchte wird im unteren Wandbereich montiert und nutzt in Kombination mit der UVC-Licht-Funktion einen Teil des natürlichen Sonnenlichtes, um Mikroorganismen wie Bakterien oder Keime abzutöten. Diese desinfizierende Wirkung kann an Waschplätzen oder im Untersuchungsbereich förderlich sein.
Kontrolle bewahren
Um Krankheiten oder ungewöhnliches Verhalten zu bemerken, kann auch die entsprechende Technik helfen: Messgeräte, die Koliken erkennen oder auch Stallkameras zum Beispiel, die zusätzlich dem Diebstahlschutz dienen. Noch einen Schritt weiter geht das Hamburger Start-up Acaris mit dem Horse Protector. Diese Kamera soll dank künstlicher Intelligenz in der Lage sein, das individuelle Verhalten der Pferde zu erlernen. Abweichungen von der Norm und Auffälligkeiten kann das System so laut Hersteller zeitnah erkennen und Betriebsleiter und Halter zum Beispiel im Falle einer Kolik warnen. Die Acaris-App ermöglicht es den Nutzern jederzeit auf die Daten zuzugreifen.
Wenn ein oder mehrere erkrankte Tiere auf dem Betrieb versterben, gilt es schnell zu handeln und sowohl den Halter als auch die Tierkörperverwertung unmittelbar zu verständigen. Nachdem das Tier abgeholt wurde, muss alles gründlich desinfiziert werden. Bestehen Zweifel bezüglich der Todesursache, rät Dr. Kasparek, den Tiergesundheitsdienst zu verständigen: „Dieser obduziert das Tier und stellt einen schriftlichen Befund aus. Die Option sollte man dem Besitzer des Tiers immer anbieten und auch falls der Einsteller das ablehnt, schriftlich festhalten, dass man die Möglichkeit erwähnt und das Angebot gemacht hat.“
Fazit
Gestütsleiter tragen Verantwortung für die Pferde, müssen aber zugleich die individuellen Wünsche der Halter berücksichtigen. Dennoch sollten sie bei grundsätzlichen Fragen wie Herpes-Impfungen oder Entwurmung möglichst übergreifende Entscheidungen treffen und diese ohne Ausnahmen umsetzen: Das dient dem Wohl der Pferde und auch dem Ruf der Anlage.
[/ihc-hide-content][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_images_carousel images=“221291,221293,221295,221297″ img_size=“full“ autoplay=“yes“][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]Dr. med. vet. Anja Kasparek geb. Schütte (Pferdeklinik Aschheim Moderne & große Pferdeklinik in Aschheim bei München (pferdeklinik-aschheim.de))
Dr. Anja Kasparek hat von 1996 bis 2002 an der Ludwig-Maximilians-Universität in München studiert und im Jahr 2005 zum Thema „Untersuchungen zum Equinen Wobbler Syndrom“ promoviert. Als Fachtierärztin für Pferde hat sie seit 2010 auch die amerikanische Zulassung (AVMA/ECFVG Zertifizierung BCSE) und ist seit 2011 Fachtierärztin für Pferdechirurgie. Im selben Jahr wurde sie Teilhaberin der Pferdeklinik Aschheim. Davor war sie von 2008 bis 2010 leitende Oberärztin der Pferdeklinik. Zudem hat sie Erfahrung als Selbständige mit Praxis und Belegärztin in Deutschland, den USA, Jordanien und Neuseeland gesammelt. Dr. Kasparek ist aktives Mitglied des BPT (Bund praktischer Tierärzte) und der GPM (Gesellschaft für Pferdemedizin) sowie des AAEP (American Associates of Equine Practitioners) mit eigenen Vorträgen, Fortbildungsveranstaltungen der Aschheimer Fortbildungsseminare und Weiterbildungen für Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr in der Großtierrettung.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_single_image image=“221299″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][vc_column_text]Im Karussell verwendete Bilder: © vchalup/adobe.stock.com © pholidito/stock.adobe.com[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]