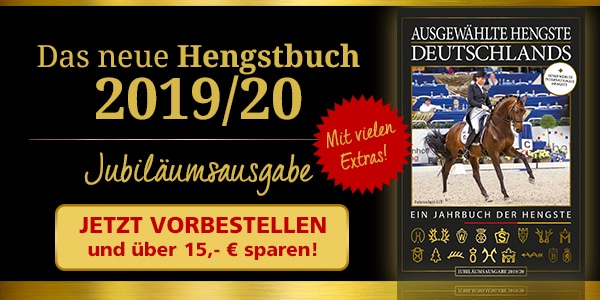Neben dem Vollblutanteil interessiert bei hochgezüchteten Rassepferden auch der Inzuchtkoeffizient. Die Bestimmung des Verwandtschaftsgrads vor einer geplanten Anpaarung ist wichtig, um die genetische Vielfalt nicht unbewusst zu reduzieren. Zudem wird so versucht, abzuschätzen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die herkunftsgleichen Gene zunehmen.
Mit dem Inzuchtkoeffizienten wird ausgesagt, wie die identischen Erbanlagen zunehmen. Zu ermitteln ist er statistisch über die Pedigreeanalyse. Paart man Halbgeschwister an, besitzt das Fohlen einen Zuwachs herkunftsgleicher Gene von 12,5 Prozent. Bei der Paarung von Vollgeschwistern liegt der Prozentsatz für den Zuwachs der homozygoten Gene bereits bei 25.
Geschlossene Rassen und Elitenbildung
Während der Entstehung der unterschiedlichen Rassen war die bewusste Inzucht unvermeidbar. Dadurch wurden der explizite Typ und die rassetypischen Eigenschaften der Rassevertreter ausgebildet und in Abgrenzung zu anderen festgehalten. Daher gilt die Inzucht als extremste Variante der Reinzucht. Im höchsten Grad sind die so gezüchteten Pferde genetisch fast identisch und können sich dementsprechend auch bei der Weiterzucht kaum verändern.
Alternativ steigt der Inzuchtgrad durch starke Elitenbildung. Kommen einzelne Vererber über Generationen hinweg bevorzugt zum Einsatz, führt auch das zu Inzucht. Auch auf zahlenmäßig strake Rassen hat es einen Einfluss auf den Inzuchtgrad, wenn wenige Starvererber zum Einsatz kommen.
Linienzucht beeinflusst Inzuchtkoeffizient
Bei Westernpferden liegt der Fokus auf der sogenannten Linienzucht, um möglichst viele Gene eines bestimmten Vorfahrens zu erhalten. Zeitgleich wird so versucht, die Nachteile einer zu engen Inzucht zu vermeiden. Das Zuchtprogramm der Linienzucht folgt konsequent einer mäßigen Inzucht. Ist der Blutanteil des Linienbegründers zu hoch, kann es mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einer Leistungsverminderung kommen. Ist der Butanteil zu gering, kommen die Erbanlagen des Stammbegründers nicht genügend bei den Nachfahren durch.
Um eine Linie aufzubauen, paart man den gewünschten Vererber mit einigen Stuten, die nicht miteinander verwandt sind, an. Von der folgenden Generation werden die besten Fohlen, welche Halbgeschwister sind, miteinander gekreuzt. Mit den daraus resultierenden Nachkommen wird gleichermaßen verfahren. Damit steigt aus genetischer Sicht das Risiko, jedoch nimmt auch die Chance zu, das gewünschte Leistungsmerkmal durch sämtliche Generation herauszuzüchten.
Risiken der Inzucht
Die Chance der Inzucht liegt in der konsequenten Vererbung eines expliziten Leistungsmerkmals. Ist der Inzuchtkoeffizient zu hoch, besteht allerdings das Risiko der Leistungsdepression. In der Folge kommt es zu unterschiedlichen unerwünschten Konsequenzen. Zu nahe Verwandtschaft beeinflusst die Größe, Fruchtbarkeit und Rittigkeit der Nachfahren. Zudem treten vermehrt Gelenksanomalien und Verhaltensstörungen auf. Daher achten erfahrene Züchter darauf, den Verwandtschaftsgrad gering zu halten, trotz der Konzentration auf das Durchzüchten bestimmter Leistungsmerkmale.
Horse-Gate/ACG