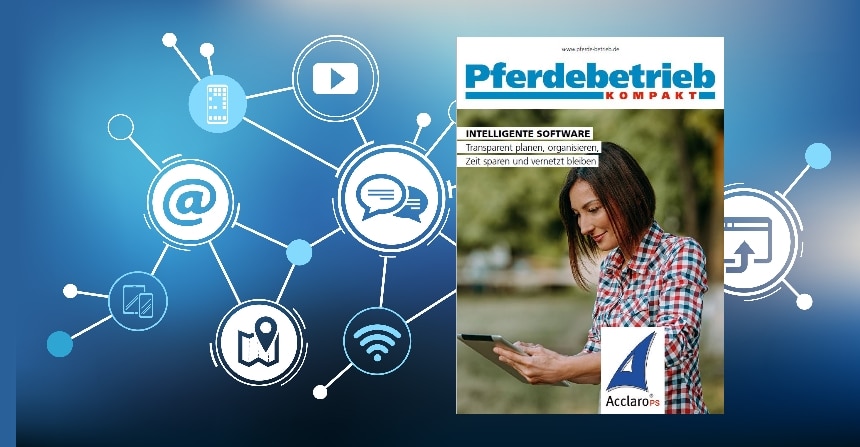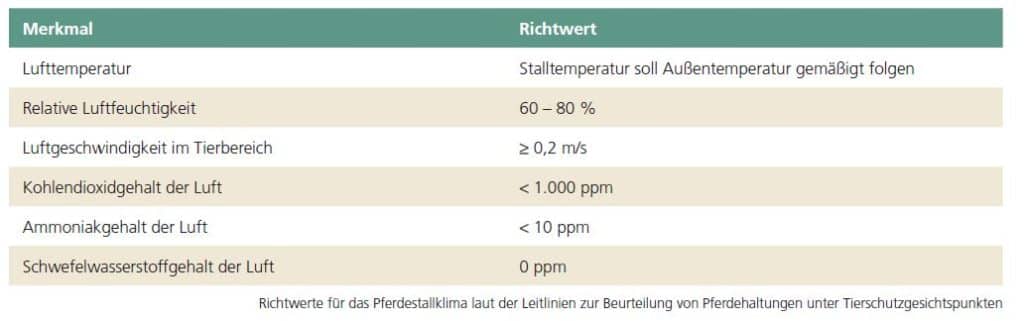[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wenn die Tage länger und die Temperaturen milder werden, dürfen die Gedanken auch wieder in Richtung Grünland und Weidesaison wandern. Die Flächen mit fachkundigem Blick zu beurteilen und auf die kommende Weidesaison vorzubereiten, ist schließlich eine der wichtigsten Aufgaben zum Jahresbeginn.
Welche Schritte nötig sind, um eine widerstandsfähige und gesunde Grasnarbe zu erhalten, darüber haben wir mit Grünland-Expertin Dr. Christa Finkler-Schade gesprochen. Lesen Sie als Exclusive-Mitglied den Fachartikel bereits vor seiner Veröffentlichung!
[ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,3″ ihc_mb_template=“3″ ]
Die erste Frage, die sich beim Blick nach draußen stellt, ist die nach dem richtigen Zeitpunkt, anzufangen. In Regionen, wo viel
Schnee liegt, heißt es erstmal abwarten, bis die weiße Pracht verschwunden ist. Allgemeiner gefasst sollte der Ausgang des Winters
der Startschuss sein. „Kurz vor Beginn der Vegetationszeit beginnt die Grünlandsaison. Das ist dann, wenn die mittlere Temperatur sich bei etwa 8 bis 10 Grad Celsius einpendelt“, gibt Dr. Christa Finkler- Schade an. Die Fläche zum ersten Mal zu begehen, empfiehlt sie jedoch bereits etwas früher, um mögliche Schäden direkt zu erkennen. „Auswinterungsschäden entstehen vor allem durch Kahlfröste und eisige Winde“, erklärt Dr. Finkler-Schade. „In Gebieten mit hohen Schneemengen besteht die Gefahr des sogenannten Schneeschimmels, den man als weißliche Auflage auch mit dem bloßen Auge erkennt und bei dem man besonders aufpassen muss, ihn nicht zu verschleppen.“
Erster Schritt: Bestandsaufnahme
Bei der ersten Bestandsaufnahme gilt es, eine Reihe von Fragen an die Fläche zu stellen:
- Wie hoch sind die Auswinterungs- und Frostschäden, insbesondere beim Deutschen Weidelgras?
* Wie hoch ist der Anteil im Vergleich zur Gesamtfläche?
* Wie aktiv waren die Mäuse (und andere Wildtiere) auf der Fläche?
* Wie viele Lücken weist die Fläche auf? (Mehr oder weniger als in vorangegangenen Jahren?)
„ Ist die Grasnarbe (stark) verfilzt?
Sieht man viel altes Pflanzenmaterial?
„ Wie hoch ist der (erkennbare) Anteil an unerwünschten Pflanzen?
„ Wie intensiv sind die Trittschäden?
„ Gibt es Staunässe im Boden oder steht das Wasser an einigen Stellen?
Ausgehend von dieser ersten und möglichst intensiven Beurteilung der Flächen gilt es anschließend, die Maßnahmen zu ergreifen,
die der Boden braucht.
Zweiter Schritt: Die Pflege beginnt!
Und damit die wichtigen Schönheitsreparaturen am Grünland, die den Rest des Jahres die Basis eines gesunden Aufwuchses bilden.
„Die erste Maßnahme ist immer das Schleppen“, hält Dr. Finkler-Schade fest. „Aber erst, wenn es dafür trocken genug ist. Verschmiert
man die Maulwurfshügel, dann ist es eindeutig noch zu nass.“ Als Faustregel für einen trockenen Boden empfiehlt sie, vorab den Test mit dem Fuß zu machen: Zeichnet sich der Absatzabdruck nicht mehr im Boden ab, kann das Schleppen beginnen. So werden Trittschäden und Aufwürfe ausgeglichen. Sind über den Winter auch Mist, Kompost oder Gülle auf den Flächen ausgebracht worden, ist das Schleppen umso wichtiger, um die Narbe zu durchlüften. Dr. Finkler-Schade gibt hier allerdings
zu bedenken: „Beim Schleppen ist das nur begrenzt möglich, aber vor allem das Entfilzen und Durchlüften der Oberfläche ist wichtig, da es die Gräser anregt, sich neu zu bestocken.“ Je mehr Licht und Luft sie für den Photosynthese-Prozess erhalten, umso besser.
Zusätzlich oder alternativ zur glatten Schleppe kann eine Schleppe mit Zähnen zum Einsatz kommen, die das Lüften vereinfacht, zugleich aber die Gefahr birgt, Grassoden herauszureißen. Ein besseres Werkzeug sieht Dr. Finkler-Schade in den Grünlandstriegeln
mit integriertem Nachsaatgerät und kleiner Walze. Die langen Zinken befördern abgestorbenes Material nach oben, entfilzen den Boden und reduzieren so unerwünschte Pflanzen wie die Gemeine Rispe. „Ohne diese Maßnahmen kann das alte Pflanzenmaterial die lebenden Pflanzen ersticken. Der Striegel bringt Luft und Licht in den Boden und die Gräser erholen sich so deutlich schneller“, erklärt die Expertin. Die einzige Ausnahme, bei der sie vom Striegel abrät, ist, wenn Schneeschimmel erkennbar ist. Es besteht die Gefahr, ihn auf der gesamten Fläche zu verteilen.
Von Lücken und Wildschäden
Wenn durch abgestorbene Pflanzen große Lücken im Aufwuchs entstanden sind oder die Mäuse unter der geschlossenen Schneedecke besonders aktiv waren, dann muss umso intensiver nachgesät werden. Die Lücken werden dabei immer anteilig zur gesamten Fläche betrachtet. Als Richtwerte nennt Dr. Finkler-Schade folgende Zahlen für eine ausreichende Nachsaat:
- „ Lücken bis 10% an der Gesamtfläche eine Nachsaat von 5 kg pro Hektar
„ Lücken von 10 bis 20% etwa 6 bis 10 kg Nachsaat pro Hektar
„ Lücken von 20 bis 30% etwa 15 bis 25 kg Nachsaat pro Hektar „
Um die Nachsaat entsprechend in den Boden einzuarbeiten, rät die Expertin bei Lücken,die mehr als 20 % der Gesamtfläche betreffen, zum Einsatz einer Schlitzdrillmaschine. Dieses Gerät schlitzt die Saat in den Boden ein und schafft so gute Voraussetzungen für ein zügiges Anwachsen. Bei geringeren Lücken reiche auch ein Striegel mit Nachsaateinrichtung oder Übersaatgerät.
Zusätzlich gibt Dr. Finkler-Schade zu bedenken: „Trockenheit und Frost können Nachsaaten zunichtemachen, was bei den trockenen Frühjahrsbedingungen in den vergangenen Jahren ein Problem war. Aber nichts zu tun ist auch keine Alternative, da die Lücken dann von unerwünschten Pflanzen besetzt werden.“ Je nachdem, wie sich die erste Nachsaat entwickelt, kann ein erneutes Säen vor allem im Spätsommer sinnvoll sein. Dann haben die jungen Pflanzen weniger Konkurrenz durch Pflanzen aus dem alten Bestand. Zeigen sich aber erste Lücken bereits im Frühling heißt es trotz Konkurrenz durch andere Pflanzen schnell handeln und nicht abwarten. „Wenn die Lücken da sind, dannmuss ich reagieren“, betont Dr. Finkler-Schade. „Und entsprechend auch die Pferde möglichst erst später auf die Fläche lassen.“ Die
Expertin empfiehlt in der Zwischenzeit eine erste Schnittnutzung durchzuführen, damit die Pflanzen genug Zeit für Ihre Entwicklung haben und nicht gleich wieder durch Verbiss und Tritt geschädigt werden.
Waren größere Tiere am Werk, können Schleppe und Striegel an ihre Grenzen stoßen. Wüten beispielsweise Wildschweinrotten auf dem Grünland, kann das eine passende Aufgabe für den Wiesenengel sein. Dr. Finkler-Schade hält fest: „Wildscheine verursachen erhebliche Schäden, da kommt man mit der Schleppe nicht weit. Der sogenannte Wiesenengel mulcht und vertikutiert, er zerkleinert und hilft bei der Nachsaat. Oft setzen auch Jäger das Gerät ein, um starke Unebenheiten auszugleichen.“ Gegen Mäuse empfiehlt Dr. Finkler-Schade ausreichend Sitzplätze für Greifvögel anzubieten und die Füchse leben zu lassen.
Neueinsaat
Eine Neueinsaat ist immer mit einem Umbrechen und damit einer kompletten Erneuerung der Grasnarbe verbunden. Dr. Finkler-Schade gibt zu bedenken: „Der komplette Narbenschluss braucht nach der Neueinsaat mindestens 5 Jahre und erst dann ist die Fläche wieder sehr gut tragfähig. Man sollte über eine Neueinsaat also wirklich erst nachdenken, wenn mehr als 40 % der Fläche stark geschädigt ist.“
Walzen & schweres Gerät
Walzen kann man im Frühling, man sollte es aber nicht überall und auch nicht jederzeit. Als wichtigstes Indiz dafür, ob das Walzen sogar schaden kann, nennt Dr. Finkler-Schadeden Feuchtegrad des Bodens: „Auf keinen Fall sollte man walzen, wenn der Boden noch zu feucht, lehmig oder tonig ist. Sonst verdichtet man den Boden und stört so langfristig dessen Kapillarfunktion, also den Luft- und Wasseraustausch, was wiederum zu Wachstumsproblemen führt.“ Auch beim Kalken des Bodens oder beim Gülle ausbringen sollte man immer das Gewicht der Maschinen mit bedenken. Um Verdichtungen und damit Schäden zu vermeiden, müssen die Flächen tragfähig – also entweder gefroren oder trocken genug – sein. „Der hohe Druck ist nicht zu unterschätzen“, betont Dr. Finkler-Schade. Die Expertin rät im Zweifelsfall zu kleinen Walzen,
die den Boden lediglich andrücken. Solche Cambridge- oder Prismenwalzen sind oft mit einem Striegel und Nachsaatgerät kombiniert. Das spart Arbeit und schont den Boden.
Sonderfall Winterweiden
Flächen, die ganzjährig von Pferden beweidet werden, weisen mehr Tritt- und Verbissschäden und auch mehr Mist auf. Werden solche Flächen nicht abgesammelt, verstärkt das Schleppen den Parasitendruck. Dr. Finkler-Schade warnt: „Wir haben bereits jetzt massive Resistenzen und damit muss man sich auseinandersetzen. Umso wichtiger ist es, die Weiden per Hand oder maschinell abzusammeln.“
Zusätzlich rät die Expertin da, wo es möglich ist, die Flächen zwischenzeitlich auch anders zu nutzen: ob für den ersten Schnitt oder als Weide für andere Tiere. Sie stellt klar: „Pferdemist ist der wertvollste Dünger überhaupt, aber eben erst, wenn er vollständig kompostiert ist. Diesen Spurenelement-reichen Kompost zu produzieren, ist eine Wissenschaft für sich.“ Das heißt aber nicht, dass man diesen Prozess nicht angehen sollte. Im Gegenteil: „Über Kreislaufwirtschaft müssen wir alle uns wieder mehr Gedanken machen. Mist nicht zu verwenden und Dünger zuzukaufen, ist für die Flächen und fürs Budget schlecht.“, fasst Dr. Finkler-Schade zusammen. Ein großes Problem, das die Expertin hier mit anspricht, ist die Flächenknappheit. Dennoch sei es wichtig, den Flächen Ruhezeiten einzuräumen und beispielsweise mit Wechselweiden zu arbeiten.
Die Mischung macht´s
Die Standardmischungen und auch die Vorgaben der Landwirtschaftskammern sollten genau geprüft werden. Oft beziehen sich die Angaben zu Saatmischungen auf die Grünlandnutzung zur Raufutterherstellung oder auf Milchvieh. Für Betriebsleiter lohnt es sich, auch Mischungen speziell für Pferdeweiden genauer unter die Lupe zu nehmen und auf den Tierbestand abzustimmen. „Je nach Pferd braucht man auch andere Sorten“, betont Dr. Finkler-Schade. „Es macht einen Unterschied, ob fünf bis zehn Zuchtstuten mit ihren Fohlen das Grünland beweiden oder eine Gruppe Freizeitpferde. Die säugenden Stuten brauchen energie- und eiweißreiches Gras, das für die Freizeitpferde zu reichhaltig wäre.“ Eine leistungsfähigere Fläche, deren Grasnarbe energie- und proteinreiches Grünfutter hervorbringt, erfordert erhöhte Weidelgrasmengen. Bei Freizeitpferden hingegen muss eher auf zucker- und fruktanarme Gräsersorten geachtet werden. Die Expertin empfiehlt Pferdehaltern und Betriebsleiter, sich entsprechend individuell beraten zu lassen.
Ob in Süd- oder Norddeutschland, das Ziel sollte immer eine möglichst vielseitige Gräsermischung sein. Dr. Finkler-Schade beschreibt den idealen Dreiklang als Mischung aus Kräutern, Leguminosen und Gräsern: „Die Kräuter wurzeln tief und leisten einen wichtigen Beitrag zur Wasserführung und Kapillartätigkeit im Boden. Leguminosen wie Klee binden den für das Wachstum der Pflanzen so wichtigen Stickstoff aus der Luft und als drittes braucht es natürlich die Gräser, die im Vergleich flacher wurzeln.“ Speziell bei trockenen Böden hilft die Kombination aus diesen drei Hauptgruppen den Böden, mehr Wasser zu speichern und den Stickstoff als einen Hauptpflanzennährstoff zu binden. Die Anbieter von Saatgut haben Mischungen für unterschiedliche Nutzungsintensitäten und Standorte. Die Landwirtschaftskammern führen auch Sortenprüfungen durch und bieten Beratung an.
Kontrolle
Die richtige Pflege ist unverzichtbar für eine gesunde Grasnarbe. Zusätzlich braucht es aber auch ein gewisses Maß an Kontrolle: Aufschluss über die Nährstoffversorgung der Böden geben Bodenuntersuchungen, die Finkler-Schade in einem Abstand von etwa zwei bis drei Jahren empfiehlt: „Zur Einhaltung der Anforderungen der neuen Düngeverordnung müssen regelmäßige Bodenuntersuchungen nachgewiesen werden. Nährstoffdefizite oder Überschüsse zeigen sich an den Zahlen und die Betriebsleiter erhalten zusätzlich zu den Ergebnissen eine Düngeempfehlung.“ Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen immer der pH-Wert sowie Phosphor, Kalium und Magnesium, zusätzlich können Natrium und Spurenelemente sowie der Humusgehalt mit untersucht werden. Stellen wie die LUFA, die LEL oder auch private Institute bieten Formblätter online zum Herunterladen an und verschicken das Material zur Probenentnahme. „Diese Pakete beinhalten eine Anleitung, wie und wo die Proben entnommen werden müssen. Ein Bohrstock zur Probenentnahme kann ausgeliehen werden“, erklärt Dr. Finkler-Schade.
Gezielt düngen
Die Ergebnisse der Untersuchungen liefern wichtige Erkenntnisse zur Düngung. Ob und wieviel Stickstoff ausgebracht werden sollte, ist jedoch nicht Teil der Bodenuntersuchungsergebnisse. Das hängt allein von der Nutzungsform und -intensität ab, wie Dr. Finkler-Schade betont: „Grünland zur Schnittnutzung hat einen höheren Stickstoffbedarf als eine reine Weidenutzung. In den Betrieben werden Jahresmengen von ca. 60-120 kg/ha durchaus eingesetzt. Je nach Nutzung sinnvoll sind kleine Gaben von ca. 30 kg nach den Nutzungen, da das natürliche Wachstum im Frühjahr ohnehin oft hoch ist.“ Vor zu hohen Stickstoffmengen auf Pferdeweiden warnt die Expertin, da sich diese negativ auf die Pferdegesundheit auswirken können. Deshalb rät Finkler-Schade auch ganz eindeutig von der gängigen Praxis ab, einmal jährlich einen Mehrnährstoffdünger auszubringen: „Das ist ein Blindflug, der zu Über- oder Unterdüngung führt, da er sich nicht zielgenau dosieren lässt.“ Dort wo Kalkbedarf besteht, muss eine Kalkung nur alle 3 Jahre bis zur nächsten Bodenuntersuchung erfolgen. Biologisch wirtschaftende Betriebe haben zur Düngung nur organischen Kompost oder Gesteinsmehle zur Verfügung. Aufgrund dessen haben sie einen deutlich erhöhten Flächenbedarf von ca. 2/3 im Vergleich zu konventioneller Bewirtschaftung, um die Qualität des Grünlandes zu erhalten.
Fazit
Langfristig ist es von höchster Priorität, die Fruchtbarkeit des Bodens und die Humusbildung zu fördern. Zu einem guten Grünlandmanagement gehören dazu immer auch Ruhephasen und Wechselbeweidung. Außerdem darf die Gesundheit der Pferde nie aus den Augen geraten. Dr. Finkler-Schade betont: „Die Weiden dienen der Ernährung und auch der Beschäftigung der Tiere. Pferdehalter müssen für eine gute Weidehygiene sorgen und so den Parasitendruck eindämmen. Zudem beugt eine geschlossene, federnde Grasnarbe Überbelastungen der Pferdegliedmaße vor.“
Autorin: Lisa Freudlsperger
[/ihc-hide-content][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]Dr. Christa Finkler-Schade
Dr. Christa Finkler-Schade ist promovierte Agrarwissenschaftlerin und Expertin zu Themen wie Fütterung, Betriebsmanagement und Aufzucht.
Sie ist selbst Reiterin sowie öbv. Sachverständige für Pferdezucht und -haltung und Beraterin bei Schade & Partner. Ihre Schwerpunkte umfassen u. a. Ernährungs- und Weidemanagement sowie Haltungskonzepte.
www.schadeundpartner.de[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_single_image image=“221979″][/vc_column][/vc_row]



 Wichtige Grundlagen bei der Planung sind die Vorgaben der DIN 0131, die unter anderem die Höhe der Pfähle und die Längen der Zaunseile sowie -bänder für Weidezäune festhält. Je nach Zaunmaterial muss beispielsweise ein maximaler Pfahlabstand von 10 m bei Stahldrähten bzw. 6 m bei Bändern eingehalten werden. Bei den Zaunleitern selbst ist der Widerstand ein wichtiger Punkt, wenn es um die Zaunlänge geht. Als Faustformel gilt: Je geringer der Widerstand, desto länger kann der Zaun sein.
Wichtige Grundlagen bei der Planung sind die Vorgaben der DIN 0131, die unter anderem die Höhe der Pfähle und die Längen der Zaunseile sowie -bänder für Weidezäune festhält. Je nach Zaunmaterial muss beispielsweise ein maximaler Pfahlabstand von 10 m bei Stahldrähten bzw. 6 m bei Bändern eingehalten werden. Bei den Zaunleitern selbst ist der Widerstand ein wichtiger Punkt, wenn es um die Zaunlänge geht. Als Faustformel gilt: Je geringer der Widerstand, desto länger kann der Zaun sein. Für die Pferdeweide gibt es die unterschiedlichsten Zaunpfosten. Sehr verbreitet sind Holz- und Metallpfähle. Beispielsweise die OcotWood-Holzpfähle oder die T-Post-Metallpfähle von AKO, die in unterschiedlichen Längen angeboten werden. Am heikelsten sind die Eckpfähle zu bewerten, da diese die größte Zugkraft aushalten müssen. Darum ist bei diesen eine sichere Verankerung im Boden wichtig. Betonieren Sie diese zum Beispiel ein. Alternativ oder ergänzend kann der Eckpfosten wie folgt abgestützt werden: In Zugrichtung der Seile werden in einem Abstand von 1,9 m zwei weitere Pfähle gesetzt. Zwischen diesen und dem Eckpfosten wird quer ein Stützpfahl mit einem Durchmesser von 10 cm befestigt. So steht der Eckpfahl stabil und kann den Zugkräften des Leitermaterials trotzen. Anschließend werden die Streckenpfähle gesetzt. Wichtig ist hier der Abstand, der je nach Zaunmaterial variieren kann. Ähnlich stabil wie die Eckpfosten müssen auch die Pfähle beim Weidetor sein. Diese sollten auf dieselbe Weise in Zugrichtung des Leitermaterials abgestützt werden. Das gilt insbesondere, wenn ein massives Eisentor zum Einsatz kommt.
Für die Pferdeweide gibt es die unterschiedlichsten Zaunpfosten. Sehr verbreitet sind Holz- und Metallpfähle. Beispielsweise die OcotWood-Holzpfähle oder die T-Post-Metallpfähle von AKO, die in unterschiedlichen Längen angeboten werden. Am heikelsten sind die Eckpfähle zu bewerten, da diese die größte Zugkraft aushalten müssen. Darum ist bei diesen eine sichere Verankerung im Boden wichtig. Betonieren Sie diese zum Beispiel ein. Alternativ oder ergänzend kann der Eckpfosten wie folgt abgestützt werden: In Zugrichtung der Seile werden in einem Abstand von 1,9 m zwei weitere Pfähle gesetzt. Zwischen diesen und dem Eckpfosten wird quer ein Stützpfahl mit einem Durchmesser von 10 cm befestigt. So steht der Eckpfahl stabil und kann den Zugkräften des Leitermaterials trotzen. Anschließend werden die Streckenpfähle gesetzt. Wichtig ist hier der Abstand, der je nach Zaunmaterial variieren kann. Ähnlich stabil wie die Eckpfosten müssen auch die Pfähle beim Weidetor sein. Diese sollten auf dieselbe Weise in Zugrichtung des Leitermaterials abgestützt werden. Das gilt insbesondere, wenn ein massives Eisentor zum Einsatz kommt. Je nach Material der Zaunpfähle und Beschaffenheit des Leitermaterials werden unterschiedliche Isolatoren genutzt. Wichtig ist die Höhe, in der diese angebracht werden. Dabei muss nicht nur die Topografie der Pferdekoppel, sondern auch die Widerristhöhe der Pferde beachtet werden. Ponys benötigen einen niedrigeren Zaun als beispielsweise Groß- oder Springpferde. „Wir empfehlen die obere Reihe des Leitermaterials nur 10 % unterhalb der Widerristhöhe des größten Pferdes zu installieren“, erklärt AKO. Das heißt beispielsweise für Ponys und Kleinpferde mit einem Stockmaß von maximal 130 cm, dass der oberste Isolator in einer Höhe von 120 cm angebracht werden sollte. Der Mittlere sollte bei 75 cm und der unterste bei rund 45 cm angebracht werden. Bei einem Großpferd mit einem Stockmaß von bis zu 175 cm sollten die Isolatoren wie folgt montiert werden: 160 cm (oben), 90 – 100 cm (mitte) und 50 cm unten. Neben den Pferden muss auch die Topgrafie der Weide beachtet werden. Denn Pferde springen nicht direkt am Zaun ab – sondern in der Regel einen Meter davor. Liegt der mögliche Absprungbereich also höher als der Punkt, in dem der Pfahl steckt, muss das bei der Montage berücksichtigt werden.
Je nach Material der Zaunpfähle und Beschaffenheit des Leitermaterials werden unterschiedliche Isolatoren genutzt. Wichtig ist die Höhe, in der diese angebracht werden. Dabei muss nicht nur die Topografie der Pferdekoppel, sondern auch die Widerristhöhe der Pferde beachtet werden. Ponys benötigen einen niedrigeren Zaun als beispielsweise Groß- oder Springpferde. „Wir empfehlen die obere Reihe des Leitermaterials nur 10 % unterhalb der Widerristhöhe des größten Pferdes zu installieren“, erklärt AKO. Das heißt beispielsweise für Ponys und Kleinpferde mit einem Stockmaß von maximal 130 cm, dass der oberste Isolator in einer Höhe von 120 cm angebracht werden sollte. Der Mittlere sollte bei 75 cm und der unterste bei rund 45 cm angebracht werden. Bei einem Großpferd mit einem Stockmaß von bis zu 175 cm sollten die Isolatoren wie folgt montiert werden: 160 cm (oben), 90 – 100 cm (mitte) und 50 cm unten. Neben den Pferden muss auch die Topgrafie der Weide beachtet werden. Denn Pferde springen nicht direkt am Zaun ab – sondern in der Regel einen Meter davor. Liegt der mögliche Absprungbereich also höher als der Punkt, in dem der Pfahl steckt, muss das bei der Montage berücksichtigt werden. Sie möchten Ihren Weidezaun nun planen? Bevor Sie Stift und Zettel bemühen, können Sie Ihre Eckdaten auch ganz bequem in den Weidezaunrechner von AKO eingeben. Wählen Sie hier einfach Ihre gewünschten Komponenten aus und schauen Sie am Schluss, welche Ausstattung Sie für Ihren Traum-Zaun benötigen. AKO führt Sie hier in 9 Schritten zum optimalen, individuellen und hütesichern Weidezaun.
Sie möchten Ihren Weidezaun nun planen? Bevor Sie Stift und Zettel bemühen, können Sie Ihre Eckdaten auch ganz bequem in den Weidezaunrechner von AKO eingeben. Wählen Sie hier einfach Ihre gewünschten Komponenten aus und schauen Sie am Schluss, welche Ausstattung Sie für Ihren Traum-Zaun benötigen. AKO führt Sie hier in 9 Schritten zum optimalen, individuellen und hütesichern Weidezaun.