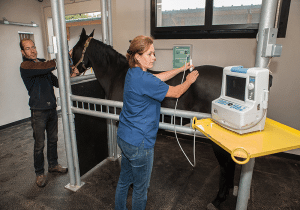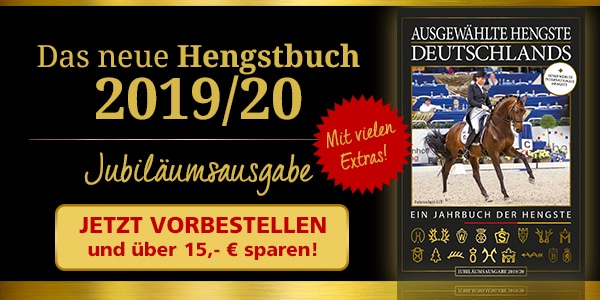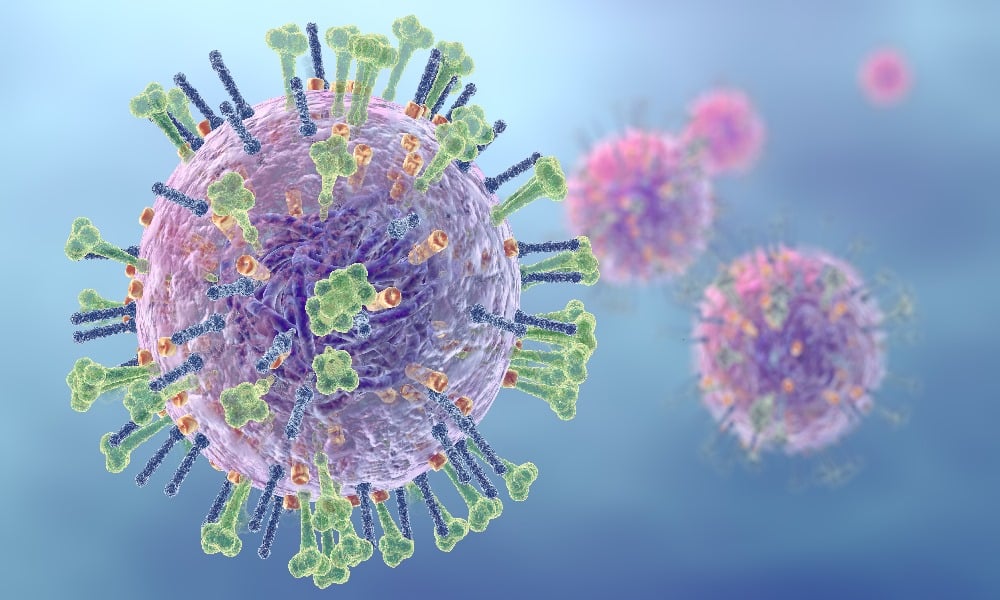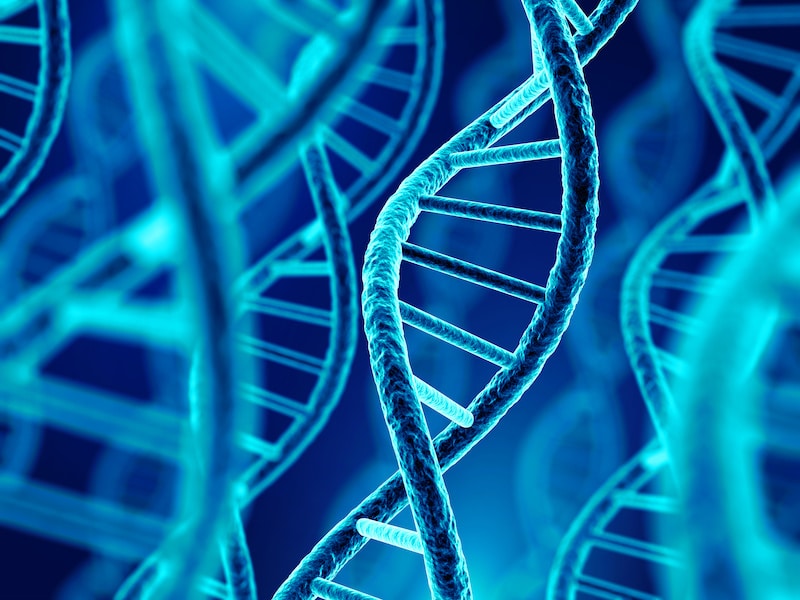Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und die Weidesaison ist vorbei. Der Winter steht vor der Tür und damit eine Futterumstellung für die Pferde. Zusätzlich ändert sich auch der Bedarf der Tiere in der kalten Jahreszeit. Mit der richtigen Fütterung kommen unsere Pferde gut durch den Winter und die damit verbundenen zusätzlichen Belastungen.
Erhöhter Energiebedarf
Seit August reduziert sich der Energiegehalt der Gräser auf der Weide, da die Vegetationsperiode sich ab da dem Ende nähert. Bereits ab diesem Zeitpunkt benötigen Pferde Zufütterung auf den mager werdenden Wiesen. Hier empfiehlt es sich, auf Heu als Hauptersatz zu setzen. Dadurch bekommen Pferde die benötigte Energie und werden bereits auf die reine Heufütterung im Winter vorbereitet. Zudem hat Heu als Raufutter einen positiven Einfluss auf die Verdauung der Tiere und mit einer allmählichen Umstellung von Gras auf Heu gelingt diese auch besser, als wenn die Pferde beziehungsweise ihr Magen-Darm-Trakt keine Zeit haben, sich daran zu gewöhnen.
Mit Einsetzen der ersten kalten Tage und Nächte erhöht sich der Bedarf an Getreide ebenfalls. Um zusätzlich Energie und einen Kick für Haut und Fell zu erhalten, bietet es sich an, dem Müsli einen guten Schuss kaltgepresstes Öl, wie Leinsamen- oder Sonnenblumenöl, beizufügen.
Im Winter steigt der Energiebedarf der Pferde an, auch wenn die tägliche Bewegung oftmals abnimmt. Sie gehören zu den sogenannten Warmblütlern, deren Körpertemperatur im gesunden Zustand konstant bei einem Wert bleibt. Um die Körpertemperatur aufrecht erhalten zu können, verwandeln sie einen Teil der zugeführten Energie in Körperwärme. Je nach aktueller Außentemperatur ändert sich der Energiebedarf für die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur. Daher wird im Winter bei niedrigen Temperaturen mehr Energie für die selbe Temperatur benötigt und der Energiebedarf der Pferde ist aufgrund dessen höher als an warmen Sommertagen.
Zusatzbelastung durch Fellwechsel
Neben dem erhöhten Energiebedarf aufgrund der sinkenden Temperatur steht mit dem Beginn der kalten Jahreszeit ein weiterer Energiefresser vor der Tür: der Fellwechsel. Um das neue Winterfell produzieren zu können, benötigen Pferde zum einen Energie und zum anderen steigt ihr Bedarf an Spurenelementen. Gerade ältere Tiere und Sportpferde brauchen hier eine unterstützende Fütterung, die wenig Eiweiß und viele Spurenelemente enthält.
Alle Informationen zum Fellwechsel und wie Pferde dabei bestmöglich unterstützen werden können, findest du in unserem Artikel dazu.
Bewegungsmangel im Winter
Eine große Umstellung von Sommer auf Winter ist der fehlende Weidegang. Das hat, wie oben erwähnt, Einfluss auf das Futterangebot, aber auch auf die tägliche Bewegung der Pferde. Darunter leiden besonders ältere Pferde, die durch das vermehrte Stehen sozusagen einrosten. Durch den Mangel an Bewegung beschleunigen sich arthritische Veränderungen wie Hufrolle oder Spat. Zumindest auf ausreichend langes Führen ist daher zu achten, wenn eine regelmäßige Arbeit nicht möglich ist. Um den Sehnen- und Knorpelapparat elastisch zu halten, kann dieser mit einer Zufütterung von Vitamin E und Spurenelementen unterstützt werden.

Aufgrund der Kälte werden Stalltüren und -fenster oft konsequent geschlossen gehalten und ohne regelmäßigen Weidegang sind die Schleimhäute der Pferde dann einer erhöhten Belastung mit Ammoniak, hoher Luftfeuchtigkeit und Staub ausgesetzt. Als Reaktion bekommen einige Tiere daraufhin Atemwegsprobleme, die der vermehrte Heustaub – auch bei gutem Heu – zusätzlich verstärkt. Etwas Unterstützung bieten hier Kräuter für die Atemwege, wie beispielsweise Thymian, Spitzwegerich und Fenchel.
Auch das Waschen des Heus senkt die Belastung durch den Staub. Wird auf eine vermehrte Kraftfuttergabe gesetzt, um weniger Heu zu füttern und die Belastung so zu senken, erfährt der Pferdestoffwechsel eine starke Belastung, die wiederum Einfluss auf den Futterzustand der Pferde hat. Als bessere Alternative zur Staubreduzierung bietet sich Heubedampfung an.
Besonderer Bedarf der Zuchtstuten im Winter
Die Hochsaison für Fohlengeburten ist das Frühjahr, sodass die Zuchtstuten im Winter tragend bis hochtragend sind – je nach Region. Besonderen Winterfutterbedarf im Verhältnis zu anderen gesunden Pferden haben sie jedoch nicht. Der gute Futterzustand und die Versorgung mit Vitaminen, Spurenelementen und Mengenelementen ist im Sommer ebenso wichtig wie im Winter.
Aufgrund der Jahreszeit und der Futterumstellung können sich jedoch Mängel bei der Nährstoffversorgung ergeben. Bei der Vorbereitung auf die Empfängnis ist ß-Carotin im Zusammenhang mit Zink für die Bildung von Fruchtbarkeitshormonen wichtig. Im Normalfall sind Stuten über frisches Gras und Heu mit reichlich ß-Carotin versorgt. Während der längeren Lagerung über den Winter wird das ß-Carotin im Heu jedoch abgebaut und die Stuten erhalten nicht mehr genug. Dies hat wiederum negativen Einfluss auf das Rosseverhalten.
Der Vitamin E-Bedarf trächtiger Stuten bleibt im Verhältnis zur Nichtträchtigkeit gleich. Jedoch kann es im Winter zu einem Mangel daran kommen, sodass eine Zufütterung in diesem Hinblick sinnvoll ist. Pflanzenöle oder gut vitaminierte Mineral- beziehungsweise Kraftfutter bieten eine gute Quelle für Vitamin E, von dem das Immunsystem entscheidend profitiert. Auch auf die Steuerung der Keimdrüsen und damit auf die Eientwicklung nimmt Vitamin E Einfluss. Somit wird auch die Wahrscheinlichkeit einer Trächtigkeit von dessen Zugabe positiv beeinflusst.
Horse-Gate/ACG