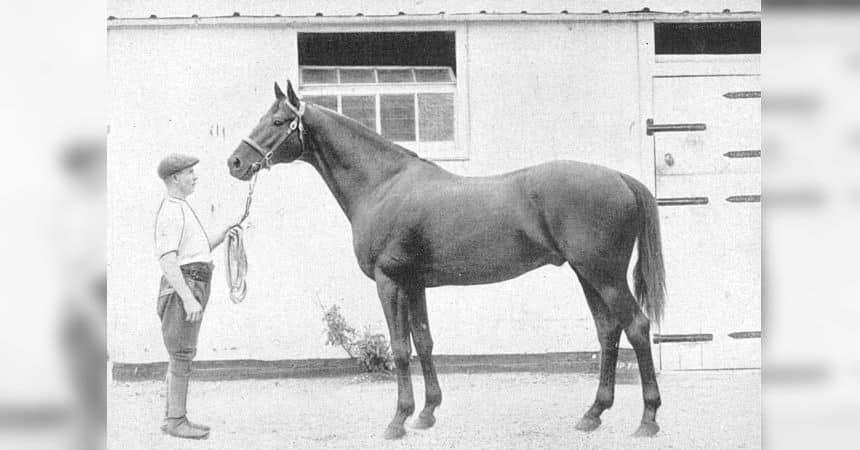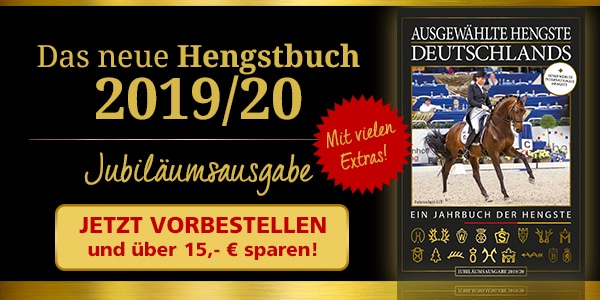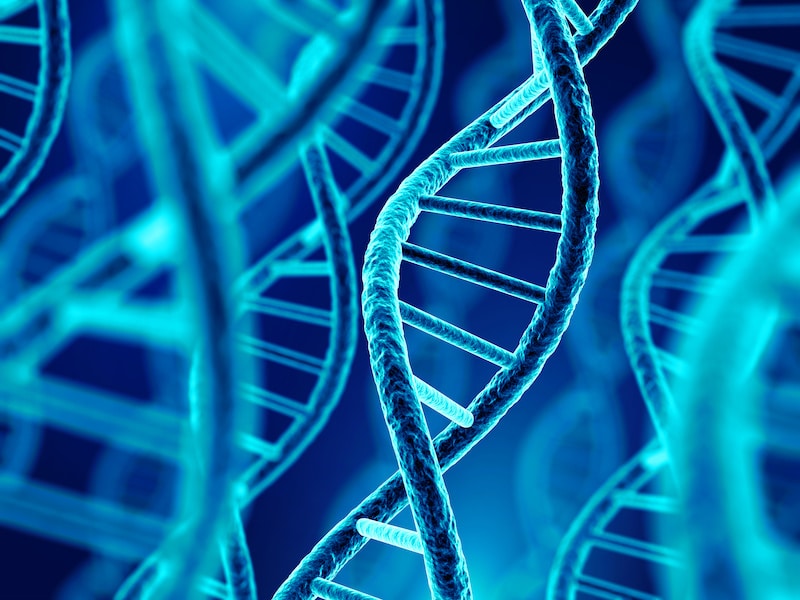Der englische Stempelhengst Dark Ronald XX wurde 2019 als möglicher WFFS-Träger ermittelt. Eine Studie der Universitäten Göttingen und Halle widerlegt diese Theorie nun. Die Ergebnisse veröffentlichten sie in der Fachzeitschrift Animal Genetics.
WFFS: Was ist das?
Das Warmblood Fragile Foal Syndrome (Link zu Hengstbuch-Artikel) ist eine (meist) tödliche verlaufende Erbkrankheit, die seit einigen Jahren für Schlagzeilen sorgt. Betroffene Fohlen haben ein sehr instabiles Bindegewebe. Bereits bei geringen Belastungen löst sich die Haut ab, die Gelenke werden instabil. Eine Behandlung gibt es bislang nicht.
Bereits 2012 konnte das betroffene Gen identifiziert werden: PLOD1 sorgt normalerweise dafür, dass Kollagen-Moleküle in der Haut und im Bindegewebe ein stabiles Geflecht bilden. Beim Gendefekt WFFS verhindert eine Mutation diese Quervernetzung. Woher die Mutation stammte, war bislang nicht klar. Dass die Verbreitung des Gendefekts in der deutschen Warmblutzucht zunehmend problematisch wurde, wurde dagegen immer deutlicher.
Woher stammt der Gen-Defekt?
Auf der Suche nach einer Antwort werteten die Vereinigten Informationssysteme Tierhaltung in Verden 2019 die Testergebnisse von rund 2.000 Pferden und deren Abstammungsdaten aus. Am Ende lag die Vermutung nahe: Der Gendefekt könnte vermutlich auf den englischen Vollbluthengst Dark Ronald XX (1905-1928) oder dessen Vater Bay Ronald XX zurückzuführen sein. Ihre Nachkommen wiederum hätten das rezessiv-vererbte Gen weitergegeben.
Die Forschungsarbeit unter Göttinger Leitung widerlegt diese Theorie nun. Der Hauptautor der Studie und Direktor des Tierärztliches Instituts der Universität Göttingen Prof. Dr. Dr. Bertram Brenig hält fest: „Uns ist jetzt der Nachweis gelungen, dass Dark Ronald XX nicht Träger der PLOD1-Mutation war und somit als Verursacher ausgeschlossen werden kann“. Bereits 2019 waren erste Zweifel an der Theorie aufgekommen, eine weitere Untersuchung legt nahe, dass der Verursacher ein 1861 geborener Hannoveraner Hengst sein könnte.
Dark Ronald XX
Dark Ronald XX hatte als Stempelhengst großen Einfluss auf die deutsche Pferdezucht. 1913 nach Deutschland verkauft, war er zunächst in Graditz und später Altefeld im Deckeinsatz. Nach einer Darmkolik 1928 verstarb der Hengst in der Tierklinik der Universität Halle. Dort befinden sich bis heute das Skelett, Herz und die Haut des Stempelhengstes. In der haustierkundlichen Sammlung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. „Das ist ein glücklicher Umstand, da wir auf diese Weise Dark Ronald XX direkt auf das Vorhandensein der PLOD1-Mutation untersuchen konnten“, erklärt Brenig. Im Fokus der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler standen kleine Stückchen der Haut. „Die Untersuchung der DNA aus der fast 100 Jahre alten Haut von Dark Ronald XX war nicht ganz einfach“, so Ko-Autorin Dr. Renate Schafberg von der Universität Halle, „da wir nichts über die Gerbung oder sonstige konservierende Behandlungen der Haut wussten“. Die Ergebnisse der Studie sind im Original in Animal Genetics erschienen.