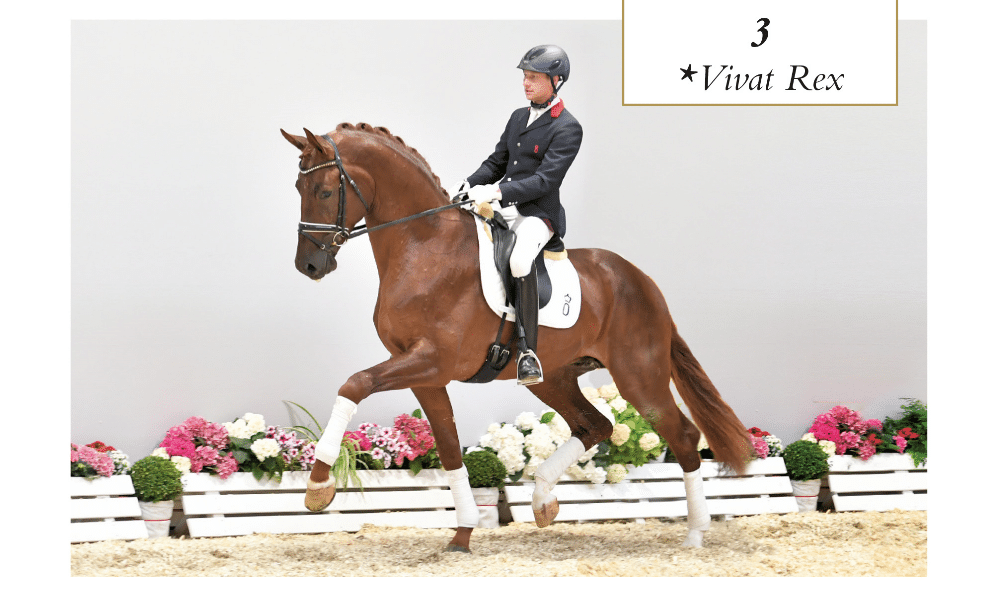[vc_row][vc_column][vc_column_text]Spätestens wenn Vertreter verschiedener Reitweisen aufeinandertreffen, beginnt die Diskussion um den perfekten Boden. Aber kann ein Boden alle glücklich machen? Welche Lösungen und Kompromisse sich anbieten, haben wir für Sie zusammengestellt.
Unterschiedliche Reitweisen und Reitsportdisziplinen stellen unterschiedliche Anforderungen an den Untergrund. Jede Reitweise verlangt vom Boden mehr oder weniger Festigkeit beim Auffußen, Dämpfung, Elastizität, Griffigkeit und Scherfestigkeit. Aber wo liegen eigentlich die Unterschiede? Im Material, im Aufbau? Es ist wohl ein bisschen von allem. Hauptbestandteil eines Reitbodens ist klassischerweise Sand. Somit haben Qualität und Auswahl des passenden Sands auch den größten Einfluss auf die späteren Reiteigenschaften.
[ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,3″ ihc_mb_template=“3″ ]
In der Regel werden für Reitböden Quarzsande verwendet, da diese durch Wasser kompakt und nicht etwa matschig werden. Wasser ist also neben dem passenden Sand der zweitwichtigste Faktor, wenn es um die Reiteigenschaften eines Bodens geht. Ein reiner Springboden wird beispielsweise in der Regel so stark gewässert, dass er das Wasser gerade noch aufnehmen kann. Dadurch liegt der Boden sehr kompakt und bietet eine extrem hohe Scherfestigkeit, also viel Grip in schnellen Wendungen. Das sorgt übrigens auch für das charakteristische Geräusch beim Galoppieren. Die Zuschlagstoffe, über die immer wieder viel diskutiert wird, haben den kleinsten Einfluss: Sie können die Reiteigenschaften eines Bodens zwar verstärken, aber nicht komplett verändern.
Spezialböden
Fachleute sind sich einig: Reitplatzböden gezielt auf eine Disziplin auszurichten, ist heutzutage kein Problem. Die größere Herausforderung ergibt sich, wenn Extreme wie Springreiten und Westernreiten mit Sliding Stops auf einer Reitanlage, sprich auf einem Boden, aufeinandertreffen. Einen Boden, der scherfest ist und gleichzeitig ein Rutschen zulässt, gibt es nicht. Die Feinabstimmung für unterschiedliche Reitweisen erfolgen bei den meisten Bödenherstellern über den Entzug oder Zugabe von Wasser. Ein zweiter Aspekt ist die Verwendung spezieller Sandmischungen. Eine Justierung kann schließlich noch über Zuschlagstoffe – beispielsweise Vlieshäcksel oder Holzhäcksel – erfolgen.
Anforderungen
Betrachtet man die Wünsche der Reiter einzelner Disziplinen näher, liegen die Unterschiede vor allem in der Tretschicht: Dressurreiter bevorzugen einen elastischen, lockeren Boden, der dennoch Trittsicherheit bietet. Springreiter trainieren gerne auf griffigen, festen Böden. Insbesondere Reitschulen brauchen ein bisschen von allem und einen guten Kompromiss, der es zulässt, eine Dressurstunde auf eine Springstunde folgen zu lassen. Kein Pferd darf ausrutschen, aber der Boden sollte dennoch weich genug sein, dass das Verletzungsrisiko für Reitschüler bei einem Sturz vertretbar bleibt. Ein solcher Boden beziehungsweise eine solche Bodeneinstellung ist für die meisten Pferde auch ein guter Kompromiss für die Alltagsarbeit.
Aufbau
Der grundsätzliche Aufbau des Reitbodens ist meist von der darauf gerittenen Disziplin unabhängig. Entscheidend sind nach Angaben von Herstellern hier Vorliebe, Pflege und der preisliche Rahmen. In der Praxis kommen heutzutage häufig sogenannte Drei-Schicht-Systeme zum Einsatz. Sie bestehen aus einer Tragschicht, einer Trennschicht und einer Tretschicht. Alternativ sind auch noch Zwei-Schicht-Plätze zu finden. Diese eignen sich nur, wenn die örtlichen Gegebenheiten stimmen. Dazu gehört die Sickerfähigkeit des Untergrunds. Alle oberflächlich entwässernden Plätze lassen Regenwasser über ein Gefälle abfließen. Früher wurde das Gefälle sehr häufig wie eine Dachlinie über die Mitte des Platzes angelegt. Das Wasser sollte dann zu beiden langen Seiten hin abfließen, weil es so den kürzesten Weg hat. Das ist theoretisch richtig, allerdings war in der Praxis das Gefälle oft schon nach wenigen Monaten verschwunden, weil es bei der Reitplatzpflege einfach weggeschleppt wurde. Heute läuft das Gefälle bei den meisten Plätzen entlang des natürlichen Gefälles der Umgebung in eine Richtung. Das macht die Reitplatzpflege deutlich einfacher und bei starkem Regen hat das Wasser nur eine Fließrichtung. Eine Alternative dazu sind vertikal entwässernde Plätze, bei denen das Wasser nach unten abfließt. Dafür werden meist Matten oder Platten verbaut und ein optional angelegtes Gefälle ermöglicht eine zusätzliche Oberflächenentwässerung. Als Drittes gibt es die Anstausysteme, auch Ebbe-Flut-Systeme genannt. Hier werden Be- und Entwässerung in der Regel vollautomatisch gesteuert.
Wasser halten und abfließen lassen
Vertikal entwässernde Reitplätze werden in der Regel mit einer Trennschicht aus Kunststoffrastern oder -matten gebaut. Auch diese tragen ganz erheblich zur Qualität des Reitbodens bei. Hier gilt es vor allem, einen guten Kompromiss beim Wassermanagement zu finden. Zum einen müssen die Raster möglichst viel Wasser nach unten durchlassen, damit sich auch bei starkem Regen keine Pfützen bilden. Zum anderen sollte noch genügend Wasser im Boden verbleiben, sodass nicht unnötig viel Wasser verbraucht wird. Etwas knifflig macht diese Aufgabe, dass nicht jede Matte und jedes Raster gleich gut auf jedem Untergrund funktioniert. Bei einem vertikal entwässernden Reitplatz spielt auch die Sickerfähigkeit des darunterliegenden Bodens eine große Rolle. Hier bleibt Pferdebetrieben vor einer Kaufentscheidung nichts anderes übrig, als sich möglichst viele Referenzbetriebe anzuschauen und dabei immer wieder die natürlichen Bodenbeschaffenheiten mit den eigenen zu vergleichen. Bei Anstausystemen spielt der natürliche Untergrund so gut wie keine Rolle, da diese Reitplätze in einer Folie liegen und damit komplett vom natürlichen Sickerverhalten des umgebenden Bodens entkoppelt sind.
Als Zwischenfazit lässt sich festhalten: Ein Schichtsystem punktet durch geringes Budget und tollem Ergebnis – fordert allerdings einen gewissen Pflegeaufwand. Anstau-Systeme sind pflegeleichter, da sich Betriebe hier das bewässern sparen können und die Reiteigenschaften sind sehr konstant. Sie sind jedoch auch teurer.
Zuschlagstoffe
Art und Menge der Zuschlagstoffe sind mitverantwortlich für die Beschaffenheit der Tretschicht und damit für die Abstimmung des Bodens auf eine spezielle Disziplin Diskussionsbedarf gibt es je nach Vorgaben der einzelnen Regionen und Bundesländer hinsichtlich nicht natürlich abbaubarer Stoffe. Allerdings werden heutzutage immer mehr natürliche und damit abbaubare Materialien entwickelt und eingesetzt. Als Material altbekannt sind Hackschnitzel. Sie werden in der Halle relativ häufig eingesetzt, hin und wieder auch auf Außenplätzen, vor allem dann, wenn das Budget eine Rolle spielt. Hackschnitzel sind durchaus in der Lage, die Reiteigenschaften eines Bodens zu verbessern, allerdings verrotten sie gerade im Außenbereich relativ schnell und verunreinigen dann den Sand. Das wäre nicht so schlimm, wenn organisches Abbaumaterial im Sand nicht gleichbedeutend mit Matsch wäre. Verrottete Hackschnitzel sorgen dafür, dass das Wasser schlechter abfließt, und der Boden wird rutschig, wenn er nass ist. Für die Hackschnitzel spricht hingegen, dass sie unkompliziert in der Entsorgung sind, relativ wenig kosten und Wasser speichern, das sie wieder an den Sand abgeben können.
Deutlich länger haltbar sind Vlieshäcksel und Vliesfasern – sie haben den Hackschnitzeln inzwischen den Rang abgelaufen. Um bezüglich Entsorgung keine Probleme zu bekommen, raten Experten, auf ein Umweltzertifikat oder eine Unbedenklichkeitsbescheinigung zu achten. Denn es gilt bereits im Vorfeld abzuklären, ob und gegebenenfalls wie die Zuschlagstoffe später entsorgt werden müssen. Abgesehen von einigen Western- und Tölt-Disziplinen laut Experten die Mehrzahl modernen Turnierreitböden inzwischen aus Sand-Vlies-Gemischen, wobei die Qualität und Produktreinheit von entscheidender Bedeutung sei.
Mehrere Hersteller setzen inzwischen auf Produkte aus natürlichen Wollfasern. Darunter ist Baumwolle oder Schafwolle. Für die natürlichen Wollfasern spricht die unkomplizierte Entsorgung und eine relativ lange Haltbarkeit, allerdings ist diese doch kürzer als bei Vlieshäcksel und Vliesfasern. Zudem verändern sie beim Verrotten die Qualität des Sands. Je nach Nutzung des Reitbodens müssen jedoch nicht unbedingt Zuschlagstoffe zum Einsatz kommen.
Wasser marsch
Eines vorweg: Über die Pflege des Bodens lassen sich Bodenbeschaffenheiten wie Festigkeit, Durchmischung und gleichmäßige Schichthöhe der Tretschicht wesentlich beeinflussen. Die optimale Pflege eines Reitbodens fängt aber nicht mit dem Reitbahnplaner, sondern mit der richtigen Dosis Wasser an. Aber nicht nur für die direkt spürbaren Reiteigenschaften ist der richtige Wasserstand wichtig. Dass ein Reitboden durch Austrocknen tatsächlich kaputtgehen kann, ist vielleicht den wenigsten Pferdebetrieben bewusst. Das Wasser sorgt dafür, dass die Tretschicht fest genug ist, um sich nicht mit dem Unterbau zu vermischen. Denn wenn Tretschicht und Unterbau einmal vermischt sind, muss der gesamte Boden mühsam abgetragen und wieder ausgesiebt werden. Auch der Sand selbst mag Trockenheit nicht, denn das Sandkorn kann durch Trockenheit porös werden. Man möchte in puncto Wasser viel Wasser im Boden erhalten, andererseits aber auch nicht zu viel haben. Um das möglich zu machen, braucht es ein ausgewogenes Zusammenspiel von richtigem Sand, passendem Unterbau und dem optimalen Beregnungssystem. Zusätzlich muss ein optimales Quergefälle geschaffen werden, um den reibungslosen Wasserabfluss zu gewährleisten.
Mehr Informationen zum Thema Reitboden bieten die kostenfreien Pferdebetrieb eBooks.
Quelle: Pferdebetrieb-Archiv
[/ihc-hide-content][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_images_carousel images=“220681,220679,220677,220675″ img_size=“full“ autoplay=“yes“][/vc_column][/vc_row]