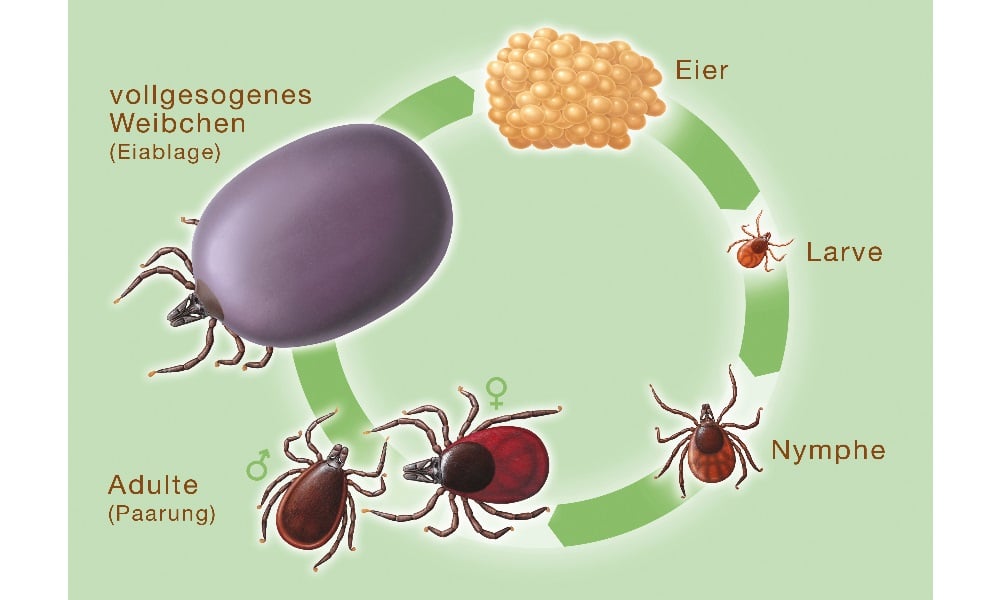[vc_row][vc_column][vc_column_text]Im Spätsommer und Herbst ist die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung an der atypischen Weidemyopathie besonders hoch. Teilweise sind Pferde auch im Frühjahr betroffen. Wie der Name schon sagt, sind ausschließlich Weidepferde gefährdet. Gerade Wiesen mit wenig Futterangebot sowie Baumbestand, auf denen im Herbst das Laub von verschiedenen Bäumen liegt, und die jahrelang als Koppeln genutzt werden, stellen eine erhöhte Gefahr dar. Hauptsächlich sind den Bundesländer Thüringen und Sachsen Fälle bekannt. Vor allem scheint die Gefahr besonders hoch nach einem plötzlichen Temperaturabfall und den ersten Nachtfrösten zu sein. Der exakte Zusammenhang ist bisher noch nicht final wissenschaftlich abgeklärt.
Krankheitssysmptome der atypischen Weidemyopathie
Erkrankte Tiere zeigen als Anzeichen oftmals Muskelzittern, einen steigen Gang, Störungen der Koordination, starkes Schwitzen, Koliken und eine erhöhte Atemfrequenz. Zusätzlich verdunkelt sich der Urin aufgrund der zerfallenden Muskelfasern, wodurch der Muskelfarbstoff Myoglobin freigesetzt wird. Schlussendlich legen sich die Pferde fest, da die Muskulatur bei atypischer Weidemyopathie gänzlich zerstört wird.
Jährlich gibt es eine Vielzahl an tödlichen Krankheitsverläufen in europäischen Ländern, da die Sterberate auch bei direkt eingeleiteter Therapie bei 90 Prozent liegt. Die Erkrankung erfolgt sehr plötzlich und verläuft zusätzlich sehr rasch innerhalb von circa 24 Stunden.
Auslöser für die atypische Weidemyopathie
Das Krankheitsbild basiert auf einer toxisch bedingten Störung des Muskelstoffwechsels. Diese wird durch Hypoglycin A ausgelöst. Das Toxin unterbindet den Fettstoffwechsel der Muskelfasern. Dadurch wird die Arbeit der Muskulatur, gerade auch die der Atem- und Herzmuskeln, deutlich erschwert. Zusätzlich schädigt Hypoglycin die Nieren.

Wissenschaftler der British Equine Veterinary Association und amerikanische Kollegen haben Eschen-Ahornsamen im Verdacht, die Vergiftung auszulösen. Der Auslöser ist allerdings noch nicht endgültig geklärt. Das Toxin Hypoglycin kommt in mehreren Ahornsamen vor, hauptsächlich in denen des Eschen-Ahorns, welcher in Nordamerika verbreitet ist. Auch der Samen des Berg-Ahorns, welcher sich in unseren Mittelgebirgen ausgebreitet hat, enthält Hypoglycin A. Der gemeine Feld- und Spitz-Ahorn scheint das Toxin hingegen nicht zu beinhalten.
Präventionsmaßnahmen
Im Normalfall fressen Pferde keine Ahornsamen. Die Gefahr steigt allerdings stark an, wenn die Weide nur spärlich bewachsen und das Futterangebot gering ist. Sind auf der Wiese Ahornbäume, ist es wichtig, den Tieren artgerechtes Futter in genügender Menge zur Verfügung zu stellen. So kommen sie wenig in Versuchung, die unattraktiven Samen zu fressen. Eine weiträumige Abzäunung der Bäume kann ebenfalls eine Lösung sein, allerdings keine endgültige. Wind kann die Samen in den Bereich der Pferde tragen. Das Risiko kann gesenkt werden, wenn die Tiere begrenzten Weidegang für einige Stunden am Tag erhalten und nicht auf stark abgeweidete Wiesen stehen. Sollten nur überweidete Koppeln zu Verfügung stehen, kann dort Heu als zusätzliches Futter angeboten werden.
Für den Fall der Fälle
Die Veterinärmedizinische Universität Wien sieht die täglich tolerierbare Menge der gefährlichen Ahornsamen für ein Pferd zwischen 26mg/kg (entspricht circa 165 Samen) und 373mg/kg (etwa 8.000 Samen). Insgesamt trägt ein Ahornbaum um die 500.000 Samen. Gerade im Herbst sollten Pferdebesitzer bei allen möglichen Anzeichen, die auch bei anderen Krankheiten auftreten, wie bspw. Koliken, die atypische Weidemyopathie im Hinterkopf haben. Die Wiener Universität rät, beim ersten Auftreten erster Symptome direkt den Tierarzt zu kontaktieren. Dieser kann nach einer Blut- und Harnuntersuchung die Diagnose stellen. Anschließend kann der positive Befund mit Kortison, Antibiotika und Schmerzmittel behandelt werden. Leider tritt nur in wenigen Fällen ein Behandlungserfolg ein.
Horse-Gate/ACG[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]