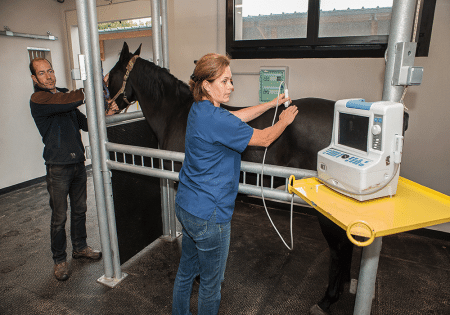Wird es künftig neben den Rankings und den Championaten weitere Möglichkeiten geben, die Zucht aus den einzelnen Ländern besser zu vergleichen? Haben Sie Pläne, um Zucht und Sport verbandsübergreifend noch transparenter zu machen?
Vor 15 Jahren war die Entwicklung von International Estimated Breeding Values (IEBVs), den internationalen Zuchtwerten, ein großes aber auch ziemlich heißes Thema innerhalb der WBFSH. Inspirationsquelle war damals Interbull, eine Technologie, die einen länderübergreifenden Vergleich von Zuchtwerten in der Viehzucht ermöglichte. Das Programm brachte gewaltigen, schnellen Zuchtfortschritt. Die Idee der WBFSH war, so ein Programm für die Pferdezucht zu entwickeln und einzuführen. Unser „Interstallion-Projekt“ musste aber damals aus politischen Gründen vorzeitig abgebrochen werden.
Warum?
Das Projekt hätte die Transparenz deutlich gestärkt. „Interstallion“ hätte ja einen unmittelbaren Vergleich der Hengste ermöglicht und dieser Gedanke hat nicht allen gefallen. Heute ist die Einstellung zu einem solchen Projekt ganz anders und der politische Wille, auf internationalen Sportergebnissen basierte IEBVs zu entwickeln, ist vorhanden. Ein solches Werkzeug wird die Welt der Pferdezucht noch viel transparenter machen. Das Projekt ist bereits in Gang gesetzt. Es ist langfristig, kompliziert und teuer, aber internationale Zuchtwerte werden ganz sicher kommen. Und auf lange Sicht gesehen werden sie wahrscheinlich unsere gegenwärtigen Hengst-Ranglisten ersetzen.
Ergibt es denn Sinn, in neue Algorithmen zu investieren statt in die menschliche Beurteilungsfähigkeit? Vorläufersysteme wie das französische ISO-Prinzip oder die deutsche Zuchtwertschätzung haben bislang nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Sind nicht am Ende die Züchter am erfolgreichsten, die ihre Stute besonders gut kennen und sie kritisch zu beurteilen wissen?
In der Viehzucht hat Interbull in kurzer Zeit einen sehr großen Zuchtfortschritt gebracht. [ihc-hide-content ihc_mb_type=“show“ ihc_mb_who=“4,3″ ihc_mb_template=“3″ ]Es ist zwar beim Rind einfacher als beim Pferd, sichere Zuchtwerte zu berechnen, aber die Experten glauben, dass es auch beim Pferd möglich ist. Das Problem mit den vorhandenen Zuchtwerten ist, dass sie nur national sind und dass keine FEI-Daten einkalkuliert worden sind. Die Zuchtwerte ziehen auch äußere Einflüsse mit in Betracht und eliminieren bei der Hengstwahl den Einfluss der Vermarktung. Internationale Zuchtwerte werden ein gutes Werkzeug sein, aber der Wert des Pferdewissens – auch in der Zukunft – darf nicht unterschätzt werden.
Neben Ihrem Amt bei der WBFSH sind Sie auch Vorsitzender des Dänischen Warmblut-Zuchtverbands, der seit vielen Jahren mit seiner Zucht ganz vorne mitmischt. Was ist das Erfolgsgeheimnis der Dänen?

Die positive Entwicklung, die der Verband der dänischen Züchter erlebt hat, ist mehreren Umständen zu verdanken. Vor allem haben wir schon immer auf eine sehr offene Politik gesetzt, wodurch wir die besten Gene für unsere Zucht zugelassen haben. Durch ein einfaches System können unsere Züchter auf Antrag auch Hengste aus anderen Verbänden für ihre Stuten nutzen. Selbst, wenn die Hengste bei uns nicht gekört sind, dürfen sie eingesetzt werden, wenn diese Hengste festgelegte Anerkennungskriterien erfüllen.
Was hat, neben der offenen Zuchtpolitik, weitere entscheidende Rollen in der Entwicklung des Verbandes gespielt?
Es hat auch eine wesentliche Rolle gespielt, dass wir ab 2004 unsere Zucht in eine spring- bzw. dressurbetonte Richtung geteilt haben. Unsere bescheidene Größe und unsere starke Marktposition in Dänemark bedeuten, dass wir flexibel sind und uns somit schnell neuem Wissen anpassen können.
War die geringe Größe des Verbandes nie ein Problem für Ihre Züchter?
Die Größe unseres Verbandes hat zur Folge gehabt, dass sich unsere Züchter seit vielen Jahren stark international orientieren und erfolgreiche Hengste aus anderen Zuchtgebieten einsetzen – davon profitieren wir bis heute.
Was wünschen Sie sich künftig für die internationale Pferdezucht und unseren Sport?
Eine noch engere Zusammenarbeit zwischen Sport und Zucht. Meiner Meinung nach sollten die Züchter in viel höherem Maße für ihre Arbeit Anerkennung finden. Diese könnte beispielsweise aus einem Anteil der Preisgelder bestehen. Schließlich werden Turniere nicht vom Reiter alleine gewonnen, ohne den Züchter gäbe es diese Erfolge gar nicht.
Jan Pedersen

WBFSH-Präsident Jan Pedersen kam 1955 in Dänemark zur Welt und studierte von 1975 bis 1981 an der Universität von Aarhus Deutsche Sprache und Dänische Literatur. Im Jahr seines Abschlusses begann er, als High-School-Lehrer am Tradium Commercial College und der Dania Academy zu unterrichten und geht dieser Tätigkeit bis heute nach. Seit 1970 widmet er sich privat erfolgreich der Pferdezucht, aus der ein gekörter Hengst, mehrere Grand-Prix-Pferde und Goldmedaillenstuten hervorgegangen sind. Jan Pedersen wuchs mit Pferden auf, sein Vater war selbst Züchter und hatte einen eigenen gekörten Hengst im Deckeinsatz. Seit 1994 ist Jan Pedersen Vorsitzender des Dänischen Warmblutzuchtverbandes. Im Jahr 1999 kam seine Tätigkeit als Vorsitzender der World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) hinzu. Von Prinzessin Benedikte wurde Jan Pedersen in Dänemark bereits mehrfach für sein außerordentliches Engagement ausgezeichnet, so erhielt er 2004 den Orden des Dannebrog-Ritters. Im April 2019 wurde er zum Ritter 1. Grades des Dannebrog-Ordens ernannt.[/ihc-hide-content]
© Dieser Auszug basiert auf einem Interview mit dem WBFSH-Präsidenten Jan Pedersen, welches Dr. Tanja Becker mit ihm geführt hat und im Sammelwerk „Ausgewählte Hengste Deutschlands 2019/20“ erschienen ist.